Vor fünf Jahren dichtete ich – war es die Pandemie oder nur gewöhnliche Todessehnsucht – folgende Zeilen: „Ich möcht‘ dabei sein, wenn der Käpt‘n spricht / vom Wetter, das jetzt naht / rough weather conditions’ und kein Land in Sicht /Augen zu, und volle Fahrt / Nah an der Klappe ist mein Logenplatz / Dort wo das Wasser im Strahl eindringt / Wenn der Sicherungsbolzen – ratzfatz – / Auf ewig in der Tiefe versinkt.“ Bisher hat sie niemand vertont. Und das abgebildete Schiff, an das ich dachte, fährt weiter vom Meer unbezwungen.
In meiner Bibliothek steht ein Meter Literatur zum Untergang der Titanic (oder war es das Schwesterschiff, wie ein Verschwörungsideologe raunte? Irgendwann Ende der 90er-Jahre stand ich auf der Brücke der MS Nils Holgersson auf dem Weg von Trelleborg nachTravemünde und fragte Kapitän Pelle Fredriksson: „Wie haben Sie denn 1994 den Untergang der Estonia erlebt?“ Der offensichtlich tiefenentspannte Schwede meinte gelassen, er habe in jener verhängnisvollen Nacht den ganzen Funkverkehr mitgehört und könne bis heute nicht verstehen, wie ein solches Schiff sinken konnte. Im Übrigen sei die Ostsee gerade sehr ruhig, und was sein Schiff betreffe: „you see, she doesn’t move“. 
Beruhigt zogen wir uns in die Kabine – ein paar Stockwerke über der Bugklappe – zurück. Bis uns gegen 2 Uhr Morgens ein Brecher weckte. Der den schwimmenden Stahlkoloss mit einem Schlag ein paar Meter nach Backbord rückte. Wiederum Jahre später vernahmen wir die beiläufige Lautsprecherdurchsage des Kapitäns des stolzen Flagschiffs der Irish Ferries – der MS Oscar Wilde – „seems we have rough weather conditions coming on“. 20 Minuten nach dem Auslaufen aus dem Hafen von Rosslare Richtung Cherbourg begann eine mehrstündige roller coaster ride auf den weather conditions der Irischen See, und wir begannen Stimmen zu hören. Stimmen sich im Strahl erbrechender Menschen und alsbald auch die Stimmen von Sängern, die von den Gewalten des Meeres kündeten und den Katastrophen, die sich dortselbst ereignet hatten.
The Wreck Of The Edmund Fitzgerald / Gordon Lightfoot
Zeit, über das Thema „Schiffsuntergänge in Rock- und Pop Songs“ intensiver nachzudenken. Das mir immer wieder im Kopf herumspukte, seit ich als noch sehr junger Möchtegern-Seefahrer zum ersten mal Gordon Lightfoots „The Wreck Of The Edmund Fitzgerald“ gehört hatte. Es ist ein Song über eine der geheimnisvollsten und meist diskutierten Schiffskatastrophen. Der in knapp sechseinhalb Minuten minutiös den Ablauf der Katastrophe schildert und dabei vollkommen ohne Refrain, Pathos, Metaphern und wirkmächtige Bilder auskommt. Allein das ständig wiederkehrende Gitarren-Motiv zwischen den Strophen klingt nach bewegter, aber zunächst eher gefahrloser See. Einzig die wohlüberlegt platzierten Schläge von Drummer Barry Keane signalisieren Unruhe und den heraufziehenden Sturm der dem Erzfrachter schliesslich zum Verhängnis werden sollte. Am 9. November 1975 lief dieses glanzlose, potthässliche Schiff „with a load of iron ore twenty-six thousand tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty“ in Superior Wisconsin aus, wie Lightfoot akkurat protokolliert. Destination Zug Island, Detroit, Michigan. Wo es nie ankam. „That good ship and true was a bone to be chewed when the gales of November came early“ führt der Song direkt zur Quelle des Unheils, und Lightfoot und packt in diesen einfachen Satz gleich die ganze Ehrfurcht und den Respekt vor den Naturgewalten hinein, gegen die der Mensch mit seiner Technik letztlich doch machtlos ist. „Lake Huron rolls, Superior sings / In the rooms of her ice-water mansion / Old Michigan steams like a young man’s dreams“.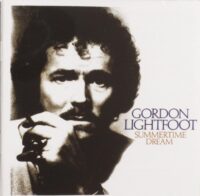
Er bezog seine Inspiration für die Lyrics vor allem aus dem Newsweek-Artikel „The Cruelest Month“ vom 24. November 1975. So wirkt der Text denn zunächst einmal wie eine nüchterne journalistischen Bestandsaufnahme der Ereignisse. Der Sänger als Diener der Chronistenpflicht. Dazu passt, dass Lightfoot in späteren Live-Aufführungen den Text des Songs immer wieder leicht modifizierte, wenn die Nachforschungen über die Unglücksursache neue Erkenntnisse zu Tage gefördert hatten. Was nichts an der intensiven Wirkung seiner Erzählhaltung ändert, die mit ihrer lakonischen Sprache in ihrer Klarheit umso erschütternder wirkt. „The dawn came late and the breakfast had to wait, when the gales of November came slashin’“. Ja, was soll schon passieren, wenn das Frühstück später serviert wird, oder? Im Gegenteil, dieser Satz lässt den Ernst der Lage als unerwünschten Gast alle Türen eintreten. Die Lage spitzt sich zu. „When suppertime came, the old cook came on deck sayin‘: Fellas, it’s too rough to feed ya. At 7 PM, a main hatchway caved in, he said: Fellas, it’s been good to know ya‘“ Mehr baucht der Texter nicht, um die Ausweglosigkeit der Situation in diesem Moment nachfühlen lassen zu können. Die Edmund Fitzgerald versank mit 29 Besatzungsmitgliedern spurlos in den Fluten des Lake Superior. Dieser Tage findet zum 50. Jahrestag des Untergangs eine Gedenkfeier im Great Lakes Shipwreck Museum in Whitefish Point statt. Unweit der Stelle, an der die Edmund Fitzgerald zum letzten Mal gesichtet wurde.
Estonia / Marillion
Now for something completely different. Dem ganz großen Pathos stets zugeneigt war die Band Marillion, das Flaggschiff des britischen Neo-Prog. Sänger Steve Hogarth, ein oft am Rande emotionaler Ejakulationen einher zitternder Stimmdramatiker kam dereinst im Flugzeug mit einem Sitznachbarn ins Gespräche. Schnell stellte sich heraus, dass seine Zufallsbekanntschaft Dokumentarfilmer war. Von Hogarth befragt, welche Art Filme er denn so drehe, berichtete er, er drehe gerade einen Film über den Untergang der Estonia. Warm? „Weil ich selbst an Bord war“. Und schon war Hogarth inspiriert zu einer der genreüblichen hochfahrenden Breitwand-Mini-Opern, die sich fast acht Minuten lang spreizt und müht, den Hörer zu packen und dabei das ganz große Besteck auspackt. Es ist das Konzept, mit gar allzu wohlklingendem, wabernden Wohlklang eher weniger wohlige Inhalte zu transportieren. Gelungene Beispiele dafür findet man etwa bei Supertramp („School“, „Asylum“) und Pink Floyd („Comfotably Numb“). 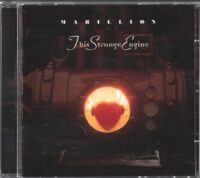
Im Fall Marillion beginnt es mit Streichern, die sich um Kopf und Kragen geigen, als wollten sie sich als Bordkapelle der Titanic bewerben. Steve Rotherys pastellfarbene folgende Gitarrenlicks malen aschliessend eine bewegte, aber im Großen und Ganzen ruhige Ostsee. You hear, she doesn’t move. Hogarths Song-Lyrics sind weniger Schilderung der Katastrophe, denn Reflexion über den Umgang der Menschen damit, nicht nur der Überlebenden und der Hinterbliebenen des September 1994, sondern all jener, die einen geliebten Menschen verloren haben. „Finding the answer / It’s a human obsession / But you might as well talk to the stones and the trees and the sea / Cause nobody knows“. Als Fazit bleibt die nicht besonders neue Erkenntnis, dass die Toten erst tot sind, wenn sich niemand mehr an sie erinnert: „No one leaves you / When you live in their heart and mind / And no one dies / They just move to the other side“.
The Rime Of The Ancient Mariner / Iron Maiden
Once again für something competely different. Selbstredend befasst sich ein Genre, das mal klingt wie Armageddon, mal wie ein Flugzeugabsturz, auch mit Schiffsuntergängen. Die Rede ist von Heavy Metal. „Water, water everywhere“ belfert der Ausguck hoch oben im Mast: Sein name aber ist Bruce Dickinson – auch bekannt als „the air raid siren“ – und er ist Kapitän Brüllvorstand der britischsten aller britischen Heavy Metal-Kapellen: Iron Maiden. Unter ihm im Maschinenraum ranunkelt seine Kapelle sklavisch im bewähren Mantel- und Degen-Groove. Die Musik hört sich an, als würde sie in Ritterrüstungen gespielt. Dieser galoppierende Groove passt nun gar zauberlich zu der schwermetallischen Aneignung von „The Rime of the Ancient Mariner“, einer Ballade des englischen Dichters Samuel Taylor Coleridge von 1798. Der gleichnamige Song erscheint auf dem 1984er-Album „Powerslave“ und ist mit über 13 Minuten Spielzeit der bis zu diesem Zeitpunkt längste in Geschichte der Band. Wie auch Coleridges Poem sein längstes ist.
Die Frage, ob es hier wirklich um einen Schiffsuntergang geht, ist obsolet. Bezöge sich das Iron Maiden-Opus nicht auf die literarische Vorlage, fände es ein Plätzchen in der Schublade „genretypische Horror-Story“. Es ist eine Geschichte von Seefahrern, von einer Expedition, von einem Fluch – ausgelöst durch die Tötung eines Albatros, der dem Schiff den Weg gewiesen hatte. Ein Fluch, der zunächst zum Tod der gesamten Besatzung des Schiffes führt und später gar wundersam durch seine Aufhebung zur Wiederauferstehung. 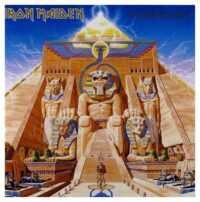
Die Band zitiert Coleridges Verse als Vehikel für ihre Nacherzählung – mit den ihr zu Gebote stehenden musikalischen Stilmitteln: Schülerband-Versatzstücke, die hohe Komponistenkunst simulieren sollen: Beschleunigen, Abbremsen, irrwitzige Taktwechsel, extreme Laut-leise-Dynamik, Herumwuchten schwerer Lasten, dann wieder hektischer Galopp, auf dem Dickinson die Worte im Stakkato auskotzen kann. „Day after day, day after day, we stuck, no breath nor motion. As idle as a painted ship upon a painted ocean. Water, water everywhere and all the boards did shrink. Water, water everywhere nor any drop to drink.“ Das passt sattelfest zum akkurat unterfütterten Doppelgitarren-Sperrfeuer – ebenso wie das vollends sinnfreie, eher gemächliche Bass-Solo im Mittelteil des Songs, das uns mit dickem Zeigefinger auf die zwischenzeitlich einsetzende Windstille aufmerksam machen will. Ganze Internet-Foren überschlagen sich mit der Exegese dieses Werkes und kommen zu wissenschaftlichen Erkenntnissen wie diesen: „The slow and dreaming section in the middle also fits very good. It is a good very good description of the old mariner slowly going completely insane on a ship on a seemingly endless silent ocean“. Wahnsinn!Jawoll! Volltreffer! Programmmusik reinsten Salzwassers! Worauf sich das Gitarrengetöse – nunmehr rhythmisch anders strukturiert – sich der Heimkehr und die Erlösung der Seefahrer von dem Fluch annimmt, unüberhörbar durch eine Reprise des Themas und des Mantel- und Degen-Grooves der ersten Minuten.
Womit Sie, verehrter Leser, vom ersten Teil dieser Betrachtungen erlöst sind. Im zweiten Teil werde ich mir unter anderem Schiffsuntergänge à la Bee Gees und Procol Harum vornehmen.
Links zum Nachhören der Songs
Gordon Lightfoot The Wreck Of The Edmund Fitzgerald“
https://www.youtube.com/watch?v=FuzTkGyxkYI&list=RDFuzTkGyxkYI&start_radio=
Marillion „Estonia“
https://www.youtube.com/watch?v=NxTleImEJ3w
Iron Maiden „The Rime Of The Ancient Mariner“
https://www.youtube.com/watch?v=OSDZj_jh5cE&list=RDOSDZj_jh5cE&start_radio=1

Und ebenfalls von Dylan (und viel besser): Talkin‘ Bear Mountain Picnic Massacre Blues“.
Es gibt dann noch Bob Dylans „Tempest“ über den Untergang der Titanic.
Oh, danke. Ich entdecke ständig was Neues. Bin halt immer noch ein Dylan-Banause.