Fast jeder Mann, der ungefähr vor 1970 geboren wurde und bis 1990 in der DDR lebte, musste dort den Grundwehrdienst in der NVA oder anderen kasernierten Einheiten ableisten. Der Autor, Jahrgang 1960, erinnert sich in neun Kapiteln an seine eigenen entsprechenden Erfahrungen.
Laut Einberufungsbefehl begann mein Grundwehrdienst am 3. November 1979. Doch hatte dieser gefürchtete Tag X, hinter dessen Wirklichkeit sich das frühere zivile Leben abrupt zu einem unbeschwerten, irgendwie kindlichen Traum verwandelte, seine Schatten schon seit Längerem vorausgeworfen. Bei der Musterung vor anderthalb Jahren waren die jungen Männer meines Jahrgangs der Erweiterten Oberschule „Philipp Melanchthon“ in Wittenberg sämtlich erfasst, begutachtet und einsortiert worden für den künftigen Dienst an der Waffe. Nur zwei von ihnen, und zwar Andreas S. aus der Parallelklasse sowie ich selbst, hatten uns nicht bereiterklärt, drei oder gar fünfundzwanzig Jahre als Unteroffizier bzw. Berufsoffizier zu dienen, sondern wirklich nur den Grundwehrdienst abzuleisten. Spatensoldaten oder gar Totalverweigerer gab es unter uns überhaupt keine.
Wie wir der Größe nach anzutreten und zu marschieren hatten, war uns von der ersten Klasse an im Sportunterricht und bei den schulischen Fahnenappellen beigebracht worden und in Fleisch und Blut übergegangen; dazu bedurfte es des erst 1978, also nach uns, eingeführten obligatorischen Wehrkundeunterrichts gar nicht. Eine benotete Disziplin in Sport war Keulenweitwurf – unschwer als Vorübung zum Handgranatenweitwurf zu erkennen. Ende der elften Klasse mussten alle Jungen unserer Schule für zwei Wochen in ein GST-Ausbildungslager nach Thüringen, wo wir in kärglichen Baracken hausten, wiederum viel marschierten, den Gebrauch von Gasmasken erlernten und uns über die Eskaladierwand schwangen.
Und obwohl der Rekrut Böttcher sogleich nach seiner Ankunft in der Kaserne eine zu einem großen Sack zusammengeknüpfte Zeltplane mit sich herumschleppte, um die komplette B/A (»Bekleidung und Ausrüstung«) abzufassen, hatte er sich schon Wochen vorher eine schwarze Reisetasche, ohne die er in keinen Urlaub hätte entlassen werden dürfen, je zweimal Nähzeug, Schuhputzutensilien, Essbesteck mit Tasche, ferner Wasch-, Zahnputz- und Rasierzeug sowie graue Wollsocken und etliche zusätzliche Kragenbinden zulegen müssen. Seinen blauen Personalausweis hatte er auf dem Wehrkreiskommando gegen einen grauen Wehrdienstausweis eintauschen müssen.
Mehr als all das bewegte ihn freilich, ob er dem Sammeltransport in der Reichsbahn stolz und widerständig mit noch immer langem Haupthaar beiwohnen, dann jedoch einem womöglich betrunkenen Regimentsbarbier sich anheimgeben sollte, oder ob es nicht besser wäre, dem Manne diesen Triumph gerade nicht zu gönnen und sich das Haar schon am letzten Tag in Freiheit von Muttern scheren zu lassen.
Ich entschied mich für die zweite Variante.
Am Potsdamer Hauptbahnhof wurden die frisch eingetroffenen jungen Männer nach ihren künftigen Einheiten vorsortiert, sodann auf LKWs in die Kaserne gefahren und dort auf dem Exerzierplatz abgeladen. Ein paar Altgediente grölten höhnisch und zeigten stolz ihre eigentlich noch sehr langen, noch unangeschnittenen Bandmaße (»Zuppis«). Ich wusste, dass die kommenden Wochen mehr oder minder übel verlaufen würden, und stellte mich fatalistisch darauf ein. Es schien mir am klügsten, nicht sofort anzuecken oder mich zu exponieren, sondern zunächst den Überblick zu gewinnen.
Weil ich mich bei den noch am selben Tag einsetzenden »Maskenbällen« – dem unter viel Gebrüll und Zeitdruck stattfindenden mehrfachen An- und Ablegen von Dienst- oder Ausgangsuniform sowie Ausrüstungen – und bald auch bei nächtlichen Probealarmen, Exerzierübungen, Sturmbahnausbildung, Bettenbau, Spindkontrolle, MPi-Schießen selten blöde anstellte und kaum Anlass bot, um von den ausbildenden Gruppenführern, vom Spieß oder von irgendwem aus den höheren Diensthalbjahren auf den Kieker genommen zu werden, handelte ich mir nicht mehr Stress ein, als normal war. Ich hatte Glück, weil ich der Situation sportlich-körperlich, intellektuell-mental und von der Geschicklichkeit her gewachsen war.
Und ich hatte Glück, weil ich in keiner der vielen landesweit berüchtigten Einheiten gelandet war, wo halbkriminelle Vorgesetzte und EKs (Soldaten im dritten, letzten Diensthalbjahr) ihren Frust unglaublich brutal an den »Frischen«, den »Zarten«, den »Sprutzen«, den »Dachsen«, den »Rotärschen« abreagierten. Im Gegenteil, in meiner Kompanie und auf meiner »Stube«, wo ich eines der acht Betten belegte, gaben gelassene, moderate Leute den Ton an. Erniedrigende Rituale und Beschimpfungen, die natürlich trotzdem an der Tagesordnung waren, ertrug ich einigermaßen stoisch, zumal sie mich nur selten persönlich trafen. Es war sonnenklar, dass wir »Keimschweine«, wir »Hüpfer« nach Dienst das Zimmer und den langen Flur bohnerten und die Kloschüsseln schrubbten oder im Klubraum, wo die altgedienten »Kollegen« Skat kloppten, wenig zu suchen hatten, doch legendäre Exzesse der EK-Bewegung etwa jener Sorte, dass ein »Glatter« in den Besenspind gesperrt wurde, nach Einwurf einer Münze zu singen hatte und, falls er sich weigerte, man die »Musikbox« auf den Kopf stellte oder aus dem Fenster warf, blieben uns erspart.
Ich war jetzt der VP-Anwärter Böttcher und diente in der 2. Kompanie der 20. Volkspolizei-Bereitschaft »Käthe Niederkirchner« in Potsdam-Eiche. Meine Ausgangsuniform (K1) war zwar die grasgrüne eines Polizisten – ich ging also als »Frosch« durch die Stadt –, doch die grünlichbraune Einstrich-Keinstrich-Felddienstuniform (K2), deren Jacke man nicht knöpfte, sondern mit Haken schloss, war dieselbe wie die eines regulären NVA-Soldaten. In die Armeesprache übersetzt war ich Soldat und besaß damit den untersten aller Dienstgrade, kenntlich gemacht mittels eines glatten Schulterstücks bar jeden Zierrats.
Über mir türmte sich eine schier unendliche Hierarchie auf. Sie bestand als erstes aus den Soldaten und Gefreiten (Unterwachtmeistern) des zweiten und dritten Diensthalbjahres. Echte Vorgesetzte waren bereits die Oberwachtmeister genannten und als Gruppenführer eingesetzten Unteroffiziere – freiwillig drei Jahre dienende, daher grundsätzlich zu verachtende ehemalige Oberschüler zumeist. Es folgten der unglaublich ungebildete und ordinäre Spieß im Range eines Hauptwachtmeisters mit zehn Jahre währendem Kontrakt, ein »Zehnender« also, welcher vor versammelter Mannschaft jemandem drohte, er würde ihn solange schleifen, bis er »glänzt wie ein Judenei«; dann der strohdumme und linkische Zugführer namens Zuck im Range eines Leutnants, der sich dem Verein für fünfundzwanzig Jahre verschrieben hatte und Sätze von sich geben konnte wie »Stehen Sie hoch!«; schließlich der ehrgeizige junge Kompaniechef Lange und dessen eher fauler Politstellvertreter Kruse, beide im Range eines Hauptmanns.
Jenseits der Kompanie gab es u.a. noch den Kommandeur, den Stabschef der Bereitschaft (Regiment) sowie den besonders gefürchteten Vau-Nuller, den Verbindungsoffizier (zur Staatssicherheit). Alle Berufsoffiziere und anfangs sogar die Unteroffiziere mussten sowohl innerhalb des Objekts als auch während eines Ausgangs draußen auf der Straße stets militärisch korrekt gegrüßt werden; geschah das nicht so, wie sie es für ordnungsgemäß befanden, wurde man zurückgeschickt, um die Prozedur einmal, zweimal, zigmal zu wiederholen. Entsprach der Sitz des Käppis oder des Koppels nicht der Dienstvorschrift, wurde man angeschnauzt und musste sein Outfit sogleich korrigieren. Trat man unrasiert oder mit ungenügend gewienerten Stiefeln oder mit nicht blütenweiß geschrubbter Kragenbinde zum Morgenappell an, musste man im Laufschritt ins Kompaniegebäude zurück; gelegentlich wurde ein solches Vergehen mit Ausgangssperre oder zusätzlichem Revierdienst geahndet. Lagen die Bettwäsche, das Laken und die grauwollene »Schwarz«-Decke nicht zentimetergenau und bügelglatt wie vorgegeben, wurde das Bett wieder eingerissen, und man durfte es erneut »bauen«, gerne auch mehrfach. Dasselbe galt für den Inhalt des Spindes, wo die Unterhemden wegen der geforderten glatten Kanten und sonstigen Maßverhältnisse mittels eingelegter Zeitungen in Form gebracht wurden.
Der Inhalt des Spindes durfte im Übrigen jederzeit von Vorgesetzten kontrolliert werden. Bücher, die nicht aus der DDR stammten, wurden sofort konfisziert. Auch Tauchsieder, um sich auf der Stube einen Kaffee zu bereiten, waren verboten und wurden regelmäßig eingezogen. Das Führen eines Tagebuches war strengstens untersagt; Briefe unterlagen – zumindest theoretisch – der Zensur. Dienstliches durfte darin nicht berichtet werden; Kontakte ins westliche Ausland sollten unterbrochen werden. Erhaltene Pakete wurden vor den Augen des Spießes geöffnet, damit er Alkohol und dergleichen beschlagnahmen konnte.
Hatte man keinen Hunger, musste man trotzdem mit den übrigen in den Essensaal einmarschieren, denn Essen war Befehl. Befand irgendein Vorgesetzter, dass die Einheit nicht ordentlich marschierte oder nicht kräftig genug dabei sang, durfte sie im Laufschritt an den Ausgangsort zurück und dort neu Aufstellung nehmen und den Weg noch einmal zurücklegen. Das ging natürlich von der Essenspause ab. Störte den Offizier immer noch etwas, ordnete er Strafexerzieren nach Dienstschluss an. Ob die Einheit Sommer- oder Winteruniform trug, war nicht vom Wetter abhängig, sondern vom Verteidigungsminister, der angeblich einen entsprechenden Befehl ausgab.
Während der Freizeit wurde die Stube zentral dauerbeschallt. Taugte die Musik ausnahmsweise etwas, drehte sie garantiert jemand leise; klang sie schrecklich, war an Lektüre oder dergleichen kaum zu denken.
Alle Zivilkleidung war verboten, eigene Unterbekleidung nur soweit erlaubt, wie sie den militärischen Vorschriften entsprach. Immerhin durfte man auch eigene schwarzgraue Socken und lange weiße Unterwäsche besitzen. Ich nutzte meist die Möglichkeit, letztere, wenn sie schmutzig war, Mutter zukommen zu lassen, um nur ausnahmsweise am kollektiven Wäschetausch teilnehmen zu müssen.
Die einzige Stelle im Spind, wo man persönliche Bilder oder dergleichen anbringen durfte, war an der Innenseite des sogenannten Wertfaches, welches ein separates Vorhängeschloss besaß. Das Innenleben des Spindes regelten akribische Vorschriften für den »Schrankbau«. Ein Fach war für die Unterwäsche und die Kragenbinden vorgesehen, eines für Speisen und Getränke, eines für das Waschzeug, ein weiteres für die Sportsachen. Im untersten Fach, mit Ablage für Schuhputzzeug, standen die Stiefel und Ausgangsschuhe. Im rechten, größeren Teil des Spindes hingen auf Bügeln die Uniformen, darüber befand sich noch ein Fach für die Kopfbedeckungen. Auf dem Spind lagen die Schutzausrüstung (Schutzanzug und Gasmaske), das sogenannte Teil 1 und Teil 2 (die Ausrüstung für den Feldeinsatz) und natürlich der Stahlhelm.
Ging man zu Bett, hatte man die Kleidung vorschriftsmäßig gefaltet auf einem Hocker mit kleiner quadratischer Sitzfläche abzulegen, die blankgeputzten Stiefel standen darunter. In der Freizeit diente dieser Hocker als einzige Sitzgelegenheit um den einzigen Tisch im Zimmer. Die Doppelstockbetten waren aus Eisen. Auf dem bei jeder Bewegung quietschenden und rasselnden Spiralfederboden lagen eine Schaumgummimatratze und ein Keilkissen. Der Bettbezug war blau-weiß kariert, das Bettzeug bestand aus einer eingezogenen und einer am Fußende abgelegten zusätzlichen grauen Wolldecke.
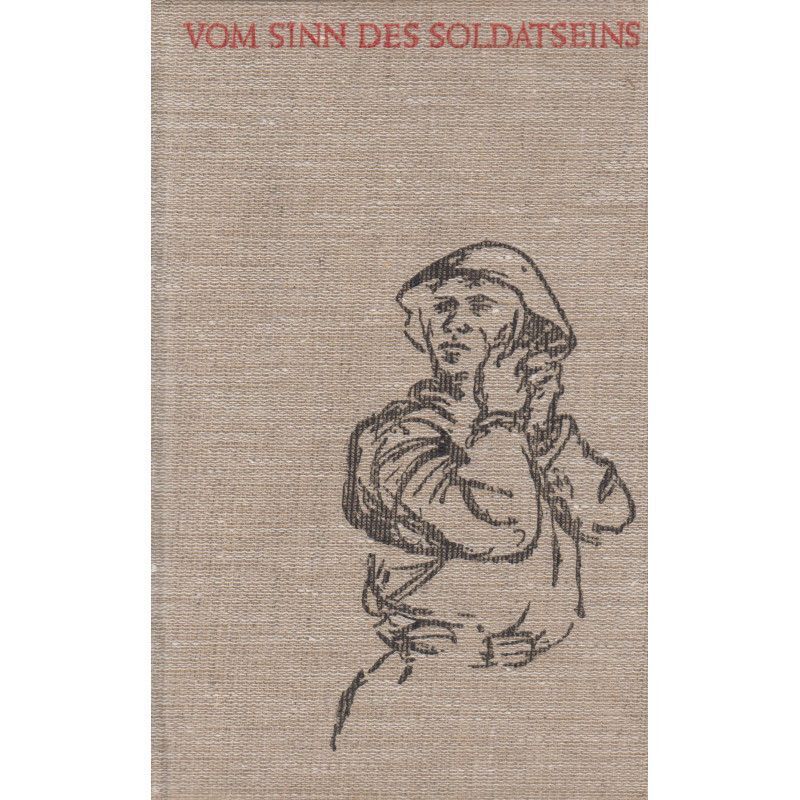
Es ist mir aufgefallen, dass vor allem Abiturienten zum „Ersatzdienst“ bei der Bereitschaftspolizei eingezogen worden sein müßten. Solche, die keinen dreijährigen Dienst machen wollten. Ist der Eindruck richtig ?
Genauso könnte ich es auch erzählen, nur zwei Jahre früher mit dem Weg aus meiner Heimatstadt Potsdam nach Torgelow-Drögerheide, ins „Land der drei Meere: Kiefernmeer, Sandmeer, nichts mehr.“ Mit 17 Jahren hatte ich all‘ meinen Mut bei der Musterung zusammen genommen und habe mich nicht zu den Grenztruppen verpflichten lassen. Nun ging’s zu den „Muckern“, ins Motschützenregiment (MSR) 9. Den Rest hat Frank Böttcher geschildert. Nach 18 Monaten fühlte ich mich mit 20, aussehend wie 15, unglaublich erwachsen. Viermal sollte ich die Kasernen der „Arbeiter-und Bauernarmee“ als Reservist bis 1987 für jeweils drei Monate wiedersehen. Dann ließ man mich in Ruhe und 1989 war dann der Spuk vorbei.