Mit 50 habe ich beschlossen, kein Jugendlicher mehr zu sein. Das merkte ich unter anderem daran, das ich nicht mehr willens war, mich in Jurys für sogenannten „Nachwuchswettbewerbe“ berufen zu lassen. Es ist ja auch nicht ganz leicht, sich den Anforderungen einer solchen Jury zu unterwerfen, wenn man selbst Musik irgendwie unsortiert empfindet. Denn wie soll ich mich in einem solchen Gremium allgemein verständlich machen, wenn ich beim sogenannten analytischen Hören von Musik gelegentlich ausrufen möchte: „Die Gitarre klingt wie ein belegtes Schwartenmagen-Brötchen, aber mit viel Senf, davon füge man bitte mehr hinzu.“ Oder auch: „Ich hätte da an dieser Stelle, gleich hinter dem zweiten Refrain, gerne einen grünlichen Keyboardsound etwas angemessener empfunden. Vielleicht sollten Sie auch etwas mehr vom Geräusch ertrinkender Jungfrauen Ihrem Klanggebilde beimischen, werter Herr!“. So rauschte es mir doch gelegentlich durch den Kopf, und das machte die Arbeit als Juror nicht eben leichter.
Zur Orientierung für die Jury gab es schlussendlich, wenn die jungen Talente dann nach einer strengen Vorauswahl auf die Bühne durften, einen Bewertungskatalog, der in pralle neun Kriterien aufgeteilt war. Von Arrangement bis Virtuosität, worüber sich trefflich streiten liess. Man konnte auch unterm Kriterium Performance darüber nachdenken, warum der Sänger mit dem Rücken zum Publikum sang. War er a) Mitglied einer okkulten Sekte? Hatte er b) panische Angst vor öffentlichen Auftritten oder hatte er gerade benmerkt, dass c) sein Hosenladen sperrangelweit offenstand?
Vor die Live-Konzerte, also das Finale, hatte man eine umfängliche Jurysitzung anberaumt. Thema: Auswahl der Finalisten. Darf man es wagen, einmal hinter die Kulissen einer solchen Veranstaltung zu blicken? Ja, man darf.
Kritiker-Elche bei der Arbeit
Wichtige Kulturpäpste und Kulturpäpstinnen dieser Stadt trafen sich da zu erregter Debatte.
Zusammengerufen wurde diese Vorab-Runde von dem damals noch jungen Sozialarbeiter Querstrich Eventmanager W, der später in seiner Freizeit Cowboystiefel anziehen und als Bob Dylan- Impersonator bevorzugt an seiner eigenen Arbeitsstätte auftreten würde. Er gab das Startzeichen. Die ehrenwerte Jury habe zu befinden über einen Haufen Kassetten, in späteren Jahren auch CDs. Um diesem notwendigen und schmerzhaften Procedere einen angenehmen Rahmen zu verleihen, habe sich der bekannter Journalist und Musikexperte L bereit erklärt, für einen Abend sein rustikales und gerade mit viel Mühe hergerichtetes Bauernhaus im Elsaß zu öffnen. 
Es gebe dort Sekt, echten Winzersekt, es werde ein eigens aufgebauter Flammkuchen-Ofen angeworfen, darüberhinaus habe man guten Bordeaux anzubieten, fünf Jahre und älter, und Eau de Vie fließe selbstredend in gastronomischen Mengen parallel, wenn man das möchte. Nebenbei müssten halt noch die paar Kassetten weggerichtet werden. Die Runde bestand aus meinungsstarken Persönlichkeiten: Eine herausragende, würdige, ja fast schon bis zur Seriosität ernsthafte und notorisch in sich ruhende Erscheinung war der Vertreter des ortsansässigen Jazzclubs namens M. Ein Herr, der trotz seines genretypischen Äußeren (geprägt von einem Bart undefinierbarer Epoche) ein offenes Ohr für gerade alles hatte, was nun überhaupt nicht mit Jazz artverwandt war, ja nach meinem Verständnis von Jazz dem geradezu diametral entgegen lärmte.
Er hatte jahrelang mit stoischer Mine ertragen, wenn eine Funkenmariechenparade der führenden Funkbands ihre hochglanzpolierte Musik einreichte. Die allesamt Wiedergänger stadtbekannter Kapellen mit originellen Namen wie „Funk Eleven“ oder „Easy Funk“ waren. Sie hatten immer eine oder mehrere Sängerinnen, die entweder aussahen wie angehende Zahnärztinnen mit Nebenfach Jura – heute würden sie vermutlich Modedesign-Branding oder Medienökologie studieren. Sie hatten immer Gitarristen, die vorm Abitur bestimmt an der Jugend-Mathematik-Olympiade teilgenommen hatten, bei der ihre Drummer den ersten Preis gewonnen hatten. Die nämlich konnten immer alles, aber spielten nur Stuss. Und alle zusammen klangen sie, als erwarteten sie die Gage in Form von Bausparverträgen oder einem Satz frisch gebügelter Hemden. Und immer, wenn sie dann gerade ihre sauber gewaschenen Händchen aufhielten, um aus der Hand der Bausparkasse, nein, der Jury natürlich, die begehrte Siegerurkunde abzuholen, da guckte der weise Herr Jazzclub so, als müsse er sich jetzt sofort übergeben. Der Mann stand auf Lärm, und das war gut so. 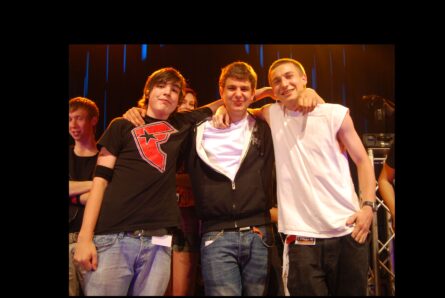
Dann war da noch lange Jahre eine Frau, die sehr schöne Sätze sagen konnte wie beispielsweise: „Bei Fury in the Slaughterhouse geht die Merchandise dieses Jahr voll gut. Ich komm´ gerade von der Tour….“ Wer solche Sätze sagen kann, der ist im Vorteil: Der Zuhörer, also ich, der ich noch nie „gerade von einer Tour gekommen war“, dachte, „wow, das ist aber echt mal Rock‘n‘Roll“ oder: die hat es ja mit echten Rockstars zu tun! Vor ihr konnte ich mich Nichtswürdiger nur in den Dreck werfen. Sie merken schon, ich fühlte mich in dieser Runde sehr wohl, wenn nicht gar zu Höherem berufen.
Ein weiterer Experte war der Toningenieur. Live-Mixer, Gourmetkoch und Weinkenner S, der als Toningenieur ein absolutes As war, insbesondere wenn es um laute Musik ging. Als Juror aber war er ein erklärter Gegner von Kunsthandwerk. Wahrscheinlich hätte er gerne flammende Reden gegen Gitarristen gehalten, die wohlkonstruierte Soli statt hilflos verstimmtem Gemurkel hervorbrachten. Vielleicht hat er es das ja auch getan, gehört hat es niemand. Er sprach einfach grundsätzlich so leise, dass ihn im zunehmend lauter werdenden Juroren-Gebrüll, im schon von Flammkuchenschwaden und Cremant-Nebeln umnebelten Gewese kein Mensch verstehen konnte.
Gott des Todes trägt Birkenstock
Später gab es dann eine Zeitlang keine Funkbands mehr, sondern vor allem zornige junge Männer, deren Bands Namen wie „Gott des Todes“ oder „Verficktes Blutbad“ zu Gesicht gestanden hätten. So richtig merkte man das erst, wenn man sie später, Wochen nach der Abhörkonferenz live bewundern konnte. Ein besonderes Überhaupt-Nicht-Alleinstellungsmerkmal war ihr durchweg tiefergelegter Gesang, der oft in schönem Kontrast zu ihrem sonstigen Stage Acting (ein weiteres der neun Bewertungskriterien) stand. Da standen diese verschüchterten Kerle, ach was: Buben! Nein, badische Bübchen – in Shorts, bunten Hemden und Birkenstock-Sandalen auf der Bühne und versuchten, hässlich zu sein. Während ihre nervös schwitzenden Zehen hoch und runter klappten wie bei einer Don Martin Figur, war die sehr badische Ansage zu vernehmen, eher gepiepst als gesprochen: „S‘ negschde Lied handld wieda vunn Tod unn Verderwe“ (Das nächste Lied handelt von Tod und Verderben), woraufhin der Gitarrist seinen Kampfarm kreisen liess und der Sänger seine Zehen herunterklappte und mit fünf Oktaven tieferer Stimme grunzte „Blood, Blood! It‘s raining Blood!“
Und was hatte uns Juroren dazu gebracht, diese wunderlichen Bands unbedingt in die Endrunde zu befördern? Es war der der Winzersekt, der fünf Jahre alte Bordeaux, die nie versiegende Quelle des Eau de Vie. Die Kombination führte zu fortgeschrittener Stunde zu einem tieferen Verständnis all der rätselhaften Zeichen, die die eingereichten Kassetten aussandten. Am Ende, als der Gastgeber unserer Sitzungen – der großzügige Journalist – schon angemessen porös, schweisssprühend und schwer atmend auf dem Tisch stand und aus kaum nachvollziehbaren Gründen das komplette Uriah Heep-Repertoire sang, trafen wir nach kontroverser Diskussion und ab und an auch unter gegenseitigen wüsten Beschimpfungen Entscheidungen, an die wir uns am nächsten Tag nur schemenhaft und nur mit Hilfe des bemitleidenswerten Sozialarbeiters/Eventmanagers W erinnern konnten, der sich offenbar selbst gegenüber Dritten eine Schweigegelübde auferlegt hatte. Denn in einem waren wir uns immer einig: „Wie gut, dass niemand ahnt, wie unsere Entscheidung zustande gekommen ist!“ Bis jetzt hat es ja auch nie jemand erfahren.
Thomas Zimmer schreibt seit 1980 über Rock, Pop und Folk. Er war Rundfunk-Musikredakteur, Dozent für Pop- und Rockgeschichte an der Musikhochschule Karlsruhe. Er hat u.a. die Biografie des BAP-Drummers Jürgen Zöller und ein Buch mit Konzertkritiken aus 20 Jahren veröffentlicht. Er hat Rock-Größen wie Phil Collins, Ian Gillan, Beth Hart und viele mehr interviewt. Er moderiert eine regelmässige musikalische Live-Talkshow im Jazzclub Bruchsal und betreibt den Interview-Podcast „Das Ohr hört mit“ – https://open.spotify.com/show/4FuFLyd1w66aRSnYYdCkOY mit Musikern und anderen Kulturmenschen.
