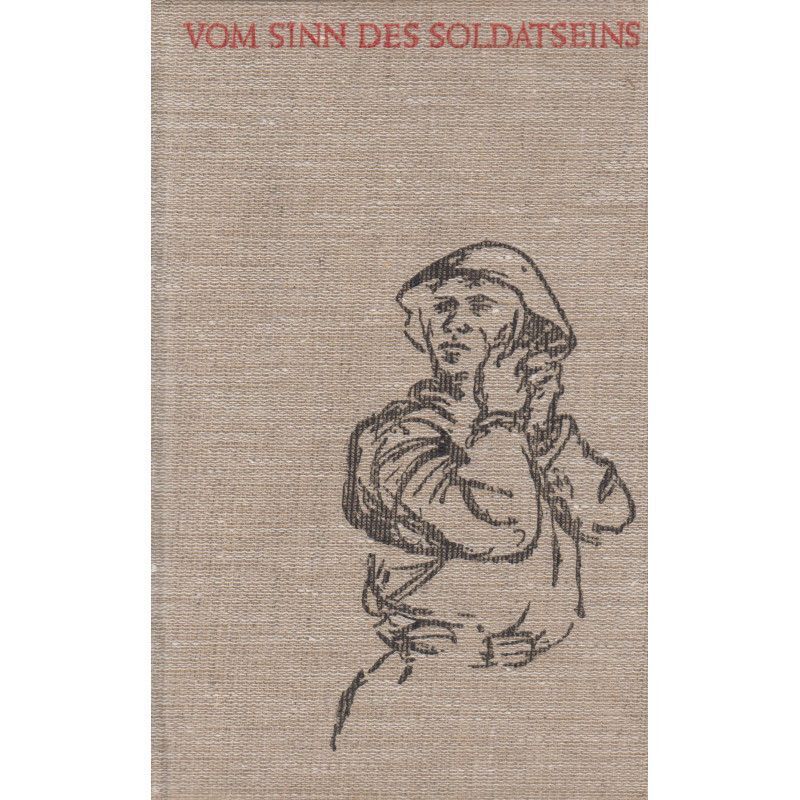Fast jeder Mann, der ungefähr vor 1970 geboren wurde und bis 1990 in der DDR lebte, musste dort den Grundwehrdienst in der NVA oder anderen kasernierten Einheiten ableisten. Der Autor, Jahrgang 1960, erinnert sich in neun Kapiteln an seine eigenen entsprechenden Erfahrungen.
Kapitel 2
Neben meiner, der 20., gab es innerhalb der Kasernenmauern noch eine weitere, die 3. VP-Bereitschaft. Jede Bereitschaft besaß fünf Kompanien, welche wiederum in drei Züge und schließlich Gruppen sowie je einen Kompanietrupp unterteilt waren. In der Regel lebten die gut hundert Mann einer Kompanie in je einem separaten Block. Außerdem wurde meinem Fenster gegenüber ein Neubau hochgezogen, welcher demnächst eine strengstens geheime, extrem scharfe Elite-Einheit im Stile der bundesdeutschen Anti-Terror-Truppe GSG 9 beherbergen sollte. So war ich in den kommenden anderthalb Jahren / achtzehn Monaten / 545 Tagen fast ausschließlich von mehr als tausend uniformierten, überwiegend eingesperrten, einem engen Verhaltenskodex unterworfenen Männern umgeben.
Wenn ich mich in meiner frischen Uniform im Spiegel betrachtete, empfand ich den Anblick als jämmerlich. Ich hätte heulen mögen. Aber Selbstmitleid half ja nicht weiter. Ich wusste, ich würde mich nicht nur mit der Kluft leidlich arrangieren müssen, sondern mit allem, wofür sie stand: den Stumpfsinn und die Kargheit des militärischen Alltags, die politische Indoktrinierung, die sprachliche Verwahrlosung, die beständige Entpersönlichung und Erniedrigung. So sehr mir das klar war, so sehr war ich gewillt, mich davon niemals zur Gänze gefangen nehmen zu lassen. Wenigstens mein Geist, nahm ich mir vor, sollte all das unbeschadet überstehen.
Der im ganzen Land verbindliche Dienstplan zergliederte die folgenden 78 Wochen in ein kleinteiliges und langweiliges Einerlei nahezu identischer Abläufe. Punkt 6.00 Uhr pfiff der Unteroffizier vom Dienst (UvD) oder dessen Gehilfe (GUvD) und brüllte »Zweite Kompanie aufstehen!« Fünf Minuten mussten den schlaftrunkenen, teils noch verkaterten Soldaten genügen, um auf dem Klo ihr Wasser abzuschlagen und im weinroten Trainingsanzug draußen vor dem Kompaniegebäude in Reih und Glied anzutreten. Ihre schlechte Laune äußerten sie durch kollektives lautes Furzen. Es folgten zwanzig Minuten Frühsport unterschiedlicher Intensität; bei mieser Laune des Vorgesetzten konnte die Sache in einen Zweitausendmeterlauf oder in heftige Kraftsportübungen ausarten.
Bis 7.00 Uhr war Zeit, um sich an einer Art langem Viehtrog zu waschen, anzuziehen und die erste Stuben- und Revierreinigung des Tages zu absolvieren. Das Besteck in der seitlichen Hosentasche, die hässliche braune Plastetasse in der rechten Hand, jedoch ohne Koppel und Käppi, rückte die Einheit im Gleichschritt in den Essensaal ein, wo es pappiges Weißbrot, Marmelade, fettige Wurst und einen sehr süßen Ersatzkaffee gab. Das erste Diensthalbjahr kam als letztes an die Reihe und musste sich beim Essen sehr beeilen, denn bereits zwanzig Minuten später beanspruchte die nächste Einheit die Tische, die vorher natürlich auch noch gesäubert werden mussten.
7.45 Uhr war Morgenappell. Die Gruppenführer, der Spieß oder gar der Kompaniechef kontrollierten die Sauberkeit und den Sitz der Uniformen, den Glanz der Stiefel, den Haarschnitt, die Rasur der noch unausgeschlafenen Angetretenen, verbreiteten mehr oder weniger schlechte Laune und teilten mit, wie der Tag ablaufen würde. Um acht begann die Ausbildung. Die vier Wochen währende Grundausbildung der Rekruten war mit Recht gefürchtet; alles Künftige war dann aber meist nur Routine und Auffrischung. Sturmbahn, simulierte Sturmgefechte durch künstlichen Nebel, Kraftsport, das Anlegen und Einpacken der Schutzausrüstung, das Auf- und Absitzen vom Transport-LKW, Häuserkampf mit Übungshandgranaten, die Benutzung des Gummiknüppels und des Schutzschildes, ferner der Pistole Marke »Makarow« und der Kalaschnikow-MPi, das akribische Auseinandernehmen, Reinigen und Zusammensetzen derselben, das Bergen und Versorgen von Verwundeten, diverse Eil- und Orientierungsmärsche, endloses Exerzieren im Stechschritt und normal, wie benutzt man den Feldspaten zum Bau einer Verteidigungsstellung und zum effektiven Töten des Gegners – Langeweile kam vorerst wahrlich nicht auf. Die Mittagspause um 14.00 Uhr war hochwillkommen, selbst wenn das Essen nicht schmeckte, denn sie ermöglichte in der Regel auch ein kurzes Ausruhen im Bett oder das Lesen eines Briefes.
Wo all das, was wir hier in stupiden Lektionen beigebracht bekamen, in Wirklichkeit hätte angewendet werden sollen, wollte ich, wollte niemand von uns so genau wissen. Lieber amüsierte ich mich über die umständliche Detailpusseligkeit und die Langeweile, rieb ich mich an der Schikane und Schinderei der Ausbildung, als dass ich deren Zweck mir klarmachen wollte. Und ich hatte Glück, dass ich mit diesem Zweck während des gesamten Wehrdienstes nicht ein einziges Mal ernsthaft behelligt wurde.
Ein paarmal stand ich an einsamen Autobahnhaltebuchten, um der in ihren Nobelkarossen vorbeibrausenden Partei- und Staatsführung freie Fahrt zur Leipziger Messe zu verschaffen. Ich musste die schimpfenden Parkenden davon abhalten, wieder loszufahren, ehe nicht die Autobahn freigegeben war, ohne ihnen den Grund für die Sperrung verraten zu dürfen. Ein mitleidiger netter Mensch aus einem Westauto steckte mir einen Apfel zu, mit dessen Annahme ich bereits gegen die Vorschrift verstieß.
Ein andermal sollte unsere Einheit irgendein Jugendfestival mit kubanischen Gästen absichern und wurde dazu nach Rostock verlegt. Wir schliefen in einer Schule, einmal auch in einer riesigen Turnhalle, und mussten bei Aufmärschen stundenlang Kordon stehen, aber das war es auch schon. Ältere Diensthalbjahre berichteten von heftigeren Einsätzen, darunter von einer Massenschlägerei beim Werderaner Baumblütenfest, wo sie die vom Obstwein Betrunkenen auseinanderknüppeln mussten.
Die größte Angst hatten wir aber vor sogenannten Russentreibjagden. Denn es kam immer wieder vor, dass verzweifelte sowjetische Soldaten desertierten und, da sie nichts zu verlieren hatten, sich bewaffnet versteckten. In der Sowjetarmee war die Unterjochung einfacher Soldaten noch um ein Vielfaches brutaler als in der NVA; dort wurde die Prügelstrafe praktiziert, und Heimaturlaub erhielten die Muschkoten in den zwei Jahren ihres Dienstes höchstens einmal. Die deutsche Bereitschaftspolizei wurde dazu eingesetzt, in Schützenkette beispielsweise durch die Wälder zu streifen und den amoklaufenden Deserteur in die Enge zu treiben. Sobald er aufgespürt und eingekreist war, erledigten die russischen Kampfgenossen an ihrem Kameraden den tödlichen Rest.
Als im Herbst 1980 das Nachbarland Polen brodelte, litten wir wochenlang unter Urlaubssperre. Eben noch hatte ich voller Sympathie das Statut von »Solidarność« vervielfältigt, schon stand zu befürchten, dass die Armeen der übrigen Warschauer Vertragsstaaten wie vormals 1968 in die ČSSR nun in Polen einmarschieren würden, um den Aufruhr blutig niederzuschlagen. Ich war verzweifelt, denn ich wusste wirklich nicht, wie ich mich, hätten sich die Führungen der übrigen Warschauer Vertragsstaaten zu einem derart katastrophalen Schritt entschlossen, verhalten sollte. Befehlsverweigerung? Mit allen Konsequenzen? Knast im berüchtigten Militärgefängnis Schwedt? Zum Glück ging der bittere Kelch, mich entscheiden zu müssen, an mir vorüber. Die Urlaubssperre wurde aufgehoben; der polnische General Jaruzelski versuchte ein Jahr später im Alleingang, sein aufgebrachtes Volk unter die Knute des Kriegsrechts zu zwingen.
Ein letztes Mal war ich mit den potenziellen Konsequenzen meiner militärischen Ausbildung am 7. und 8. Oktober 1989 konfrontiert, als Bereitschaftspolizisten in Berlin und anderswo friedlich demonstrierende Bürger zusammenschlugen und jagten, um sie auf LKWs zu pferchen und dem Stasiknast »zuzuführen«. Drei Wochen zuvor hatten Josephin und ich in Leipzig selbst mitdemonstriert; massiv begleitet wurde unser Zug ebenfalls von Bereitschaftspolizei, die damals jedoch nicht gegen uns vorging. Hätte sie es getan, hätten wir, das wusste ich, unbedingt fortlaufen müssen, was die Beine hergaben. (Josephin war mit Lisa schwanger!)
Dass ich dann in Berlin – anders als manche meiner Freunde und Bekannten – nicht unter den Demonstrierenden und womöglich Verhafteten war, lag nur daran, dass ich mit dem gerade erst ein Jahr alten Lukas allein zu Hause saß und für ihn sorgen musste. Glück gehabt. Das noch größere Glück bestand freilich darin, dass ich zwar Bereitschaftspolizist, jedoch nur einer im Status der Reserve war. Denn meine militärische Ausbildung hatte ja eigentlich exakt darauf abgezielt, in einer Situation, wie sie jetzt endlich eintrat und die ich rückhaltlos unterstützte, auf der Seite der Staatsmacht mit Waffengewalt gegen das eigene Volk und das eigene politische und menschliche Gewissen vorgehen zu können und vorgehen zu müssen. Der 2007 im Lukas Verlag erschienene Bild-Text-Band »Linienuntreue« enthält ein paar Fotografien, auf denen am 7. Oktober 1989 Potsdamer Bereitschaftspolizisten aus der 9., der 5 sowie »meiner« 20. Kompanie einen einschüchternden Kordon gegen Demonstranten bilden und sie gewaltsam auf die Ladefläche eines LKW zwingen.